Schweizer Arbeitgeber von Telearbeitern, die französische Grenzgänger sind
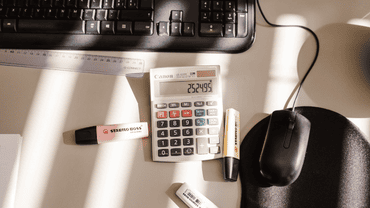
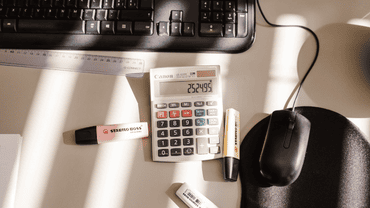
Letzte Frist am 30. Juni 2024
Um die Zwangsabgaben (Quellensteuer und Sozialversicherungsbeiträge) zu vermeiden, die zu den höchsten in Europa gehören, müssen telearbeitende Grenzgänger die Höchstgrenze für Telearbeit in Frankreich einhalten und ihre A1-Bescheinigung haben (siehe unten).
Seit dem Inkrafttreten der bilateralen Abkommen im Jahr 2002 können Arbeitgeber relativ leicht Grenzgänger ohne Kontingentierung einstellen, was dank der guten Konjunktur in der Genferseeregion zu einem stetigen Anstieg ihrer Zahl geführt hat, die sich in Genf verdreifacht (über 105’000 bis Ende 2023) und im Kanton Waadt vervierfacht hat (über 45’000 bis Ende 2023).

Mit den Gewohnheiten, die während der Pandemie mit der für Telearbeiter geltenden Ausnahmeregelung eingeführt wurden, wollten einige Grenzgänger weiterhin Telearbeit leisten, um Fahrten und die wenigen Unannehmlichkeiten, die die Präsenzarbeit mit sich bringt, zu vermeiden.
Arbeitgeber, die der Telearbeit nach dem 1. Juli 2023 zugestimmt haben, wären gut beraten, sich über die damit verbundenen Risiken sowie die zu treffenden Vorsichtsmaßnahmen zu informieren, um dieser Praxis einen Rahmen zu geben und bestimmte Risiken zu vermeiden, insbesondere das Risiko, die französischen Zwangsabgaben (Steuern und Sozialabgaben) zu tragen, die zu den höchsten in Europa gehören, wie die folgende Tabelle zeigt:

Arbeitgeber, die bereits Schwierigkeiten hatten, sich mit den für Grenzgänger geltenden Sozialversicherungs- und Quellensteuerregelungen zurechtzufinden, müssen nun auch die neuen Regeln beachten, die am 1. Juli 2023 in einer gewissen Eile in Kraft getreten sind. Mehr als zehn Monate nach dieser Einführung folgt eine Bestandsaufnahme der Situation.
Auf der Ebene der Sozialversicherungen
Das größte Risiko: Steuerpflicht in Frankreich zu den französischen Steuersätzen für das gesamte Einkommen des Grenzgängers aus der Tätigkeit, die er in der Schweiz und in Frankreich ausübt.
Die legale Parade: Unterhalb der festgelegten Grenzwerte bleiben und eine A1-Bescheinigung beantragen
Bei der Tätigkeit eines Grenzgängers in der Schweiz und in Frankreich gilt der Grundsatz, dass der Arbeitnehmer in Frankreich sozialversicherungspflichtig ist, wenn er 25 % oder mehr seiner Tätigkeit in Frankreich ausführt (diese Regel gilt bereits seit 2012) oder 50 % oder mehr Telearbeit in Frankreich leistet (dank des multilateralen Abkommens über soziale Sicherheit, das zwischen der Schweiz und einigen EU-Staaten unterzeichnet wurde und seit dem 1. Juli 2023 in Kraft ist).
Auch wenn die Schweiz und Frankreich die Grenze in Frankreich auf 49,9 % Telearbeit festgelegt haben, bedeutet die steuerlich festgelegte Grenze von 40 %, dass es tatsächlich diese Grenze von 40 % für die Sozialversicherung ist, die in der Praxis auch für die Sozialversicherung eingehalten werden muss (siehe unten, Abschnitt «Steuerlich»).
Pflicht zur Beantragung der Bescheinigung A1 für Telearbeiter an der Grenze
Damit das neue multilaterale Abkommen über soziale Sicherheit zwischen der Schweiz und bestimmten EU-Staaten, darunter Frankreich, zur Anwendung kommt und der Grenzgänger für seine gesamte Tätigkeit in der Schweiz sozialversicherungspflichtig bleiben kann, müssen Schweizer Arbeitgeber eine A1-Bescheinigung beantragen, indem sie bei ihrer AHV-Ausgleichskasse Zugang zur ALPS-Plattform (Applicable Legislation Portal Switzerland) beantragen.
Mit dieser A1-Bescheinigung soll gemäß den Koordinierungsregeln zwischen der Schweiz und der EU/EFTA festgestellt werden, welche nationalen Rechtsvorschriften für den Inhaber der Bescheinigung gelten (die Bescheinigung ist höchstens zwei oder sogar drei Jahre gültig und kann verlängert werden).
Der Antrag muss vor dem 30. Juni 2024 gestellt werden, da die Bescheinigung A1 aufgrund einer besonderen Übergangsregelung für alle bis Ende Juni 2024 gestellten Anträge rückwirkend den Zeitraum ab dem 1. Juli 2023 abdecken kann. Wir empfehlen Arbeitgebern dringend, diese Formalität unverzüglich nachzuholen, sofern dies noch nicht geschehen ist, da die Bearbeitung des Dossiers etwa zwei Monate in Anspruch nimmt.
Andernfalls wird die Anwendung des Abkommens nach den vorliegenden Informationen verweigert. Der Arbeitgeber müsste seinen Arbeitnehmer in Frankreich für die Einkünfte aus seiner Tätigkeit in der Schweiz und in Frankreich steuerpflichtig machen, was in Bezug auf die Kosten und den Verwaltungsaufwand deutlich aufwändiger wäre.
Dasselbe gilt, wenn der Grenzgänger in Frankreich die oben genannten Grenzen von 24.9 % üblicher Tätigkeit oder 49.9 % Grenztelearbeit überschreitet. In Frankreich wären insbesondere Verwaltungssanktionen und Geldbußen vorgesehen, wenn das Formular A1 bei einer Kontrolle nicht vorgelegt wird. Zu beachten ist, dass das Abkommen über soziale Sicherheit zwischen der Schweiz und Frankreich über Telearbeit nicht für Personen gilt, die :
- neben der Telearbeit in ihrem Wohnsitzstaat dort gewöhnlich eine andere Tätigkeit ausüben (z. B. regelmäßige Kundenbesuche, selbstständige Nebentätigkeit)
- neben der Telearbeit in ihrem Wohnsitzstaat gewöhnlich eine Tätigkeit in einem anderen EU- oder EFTA-Staat ausüben
- zusätzlich zu ihrer Arbeit für ihren Schweizer Arbeitgeber für einen Arbeitgeber in einem EU- oder EFTA-Staat arbeiten
- Haben eine selbstständige Tätigkeit
In steuerlicher Hinsicht
Das Risiko: Steuerliche Besteuerung des Arbeitnehmers in Frankreich mit Haftung des Schweizer Arbeitgebers
Die legale Parade: unterhalb der festgelegten Grenzen bleiben
Zur Erinnerung: Seit dem 1. Juli 2023 muss ein Arbeitgeber, wenn er verhindern will, dass sein Arbeitnehmer
Grenzgänger in Frankreich an der Quelle besteuert wird und dass er für die Erhebung der Steuer in
Wenn er eine französische Quellenangabe macht, muss er dafür sorgen, dass diese die folgenden drei Grenzen einhält:
- 40 % Telearbeit in Frankreich im Jahresdurchschnitt im Verhältnis zum Geschäft
- global des Grenzgängers
- Zehn Tage mit befristeten Aufträgen in Frankreich, die in
- die im vorherigen Spiegelstrich genannte Grenze von 40 %
- Fünfundvierzig Tage ohne Rückkehr zum französischen Wohnsitz pro Jahr, die alle beinhalten
- vorübergehende Dienstreisen in einen Staat, der nicht Frankreich ist
Bis zu diesen Grenzen (einen gewissen Spielraum zu behalten, ist ratsam) genießt die Telearbeit aus steuerlicher Sicht den Status eines Grenzgängers und der Arbeitnehmer wird weiterhin in der Schweiz an der Quelle besteuert oder über die Bescheinigung des steuerlichen Wohnsitzes (siehe unten) von der Besteuerung befreit.
Um zu überprüfen, ob die Quote von 40 % für Telearbeit eingehalten wird, muss auf der Grundlage einer genauen Abrechnung das Verhältnis zwischen der Anzahl der in Frankreich telearbeitenden Tage (einschließlich ggf. bis zu zehn Tage für vorübergehende Dienstreisen nach Frankreich) und der Gesamtzahl der Arbeitstage ohne Berücksichtigung von Ferien oder Wochenenden gebildet werden. Bei einer angenommenen Vollzeitbeschäftigung mit einer Anzahl von 240 Arbeitstagen liegt der einzuhaltende Grenzwert beispielsweise bei 96 Tagen Telearbeit, einschließlich des Grenzwerts für vorübergehende Dienstreisen nach Frankreich (40 % von 240 Tagen = 96 Tage).
Wenn die Telearbeitstage 40 % überschreiten, müssen die gesamten Telearbeitstage in Frankreich in Frankreich über das französische Quellensteuersystem versteuert werden, was nach dem Schweizer Strafgesetzbuch verboten ist. Es ist daher sehr wichtig, dass Sie die oben genannten Grenzen einhalten.
Zur Erinnerung: Die Bescheinigung über den steuerlichen Wohnsitz in Frankreich verlagert die Verantwortung für die Steuer auf den Arbeitnehmer.
Ein Grenzgänger, der in den Kantonen Waadt, Wallis und Neuenburg (aber auch Jura, Bern, Basel-Stadt, Basel-Landschaft oder Solothurn) tätig ist und an mindestens vier Tagen in der Woche für eine Vollzeitbeschäftigung an seinen französischen Wohnsitz zurückkehrt, zahlt in der Schweiz grundsätzlich keine Steuern, wenn er eine Bescheinigung über seinen steuerlichen Wohnsitz in Frankreich vorlegt. In diesem Fall ist er in seinem Wohnsitzstaat, also in Frankreich, steuerpflichtig.
Erinnerung: Quellensteuer für Arbeitnehmer in der Schweiz
Der Arbeitgeber muss in den folgenden Fällen die schweizerische Quellensteuer auf das Einkommen seines Grenzgängers einbehalten:
Wenn das Arbeitsverhältnis in Genf oder in anderen als den oben genannten Schweizer Kantonen stattfindet, da das System zur Bescheinigung der steuerlichen Ansässigkeit nicht gilt.
Wenn der Arbeitnehmer seinem Arbeitgeber in den im vorherigen Absatz genannten Kantonen die Bescheinigung über den steuerlichen Wohnsitz nicht ausstellt
Wenn er bei einer Vollzeitstelle nicht durchschnittlich vier Nächte pro Woche nach Hause kommt
Ein weiteres Risiko für den Arbeitgeber: die Gründung einer steuerpflichtigen Betriebsstätte in Frankreich
Die legale Parade: Vermeidung der Erfüllung der festgelegten Bedingungen oder Erfüllung der damit verbundenen Formalitäten
Telearbeit in Frankreich schafft auch das Risiko der Gründung einer Betriebsstätte in Frankreich, die insbesondere dann bestehen könnte, wenn der betreffende Mitarbeiter dort Einkünfte erzielt oder dort Geschäfte tätigt, die einen vollständigen Geschäftszyklus bilden. Die Lösung besteht darin, Angestellten, bei denen das Risiko besteht, dass sie eine solche Betriebsstätte gründen, die Telearbeit zu verweigern oder die entsprechenden Formalitäten mit der Unterstützung einer lokalen Buchhaltungs- und Steuerkanzlei in Frankreich zu erledigen.
Auf rechtlicher und vertraglicher Ebene
Das Risiko: Anwendung des französischen Rechts und die Kosten der Telearbeit
Die Parade: die Telearbeitsvereinbarung
Das französische Arbeitsrecht wird auf das Arbeitsverhältnis zwischen dem Arbeitgeber und dem Arbeitnehmer, der in Frankreich Telearbeit leistet, angewendet.
Da Schweizer Arbeitgeber meist nichts über das französische Arbeitsrecht wissen, ist es daher angebracht, dessen Anwendung einzuschränken, ohne sie jedoch ausschließen zu können, da das zwingende französische Arbeitsrecht in jedem Fall für den Teil der Tätigkeit, den der Arbeitnehmer in Frankreich ausübt, Anwendung finden wird.
Es wird empfohlen, in der Telearbeitsvereinbarung mit dem Mitarbeiter festzulegen, dass die Telearbeitstätigkeit in Frankreich auf Antrag des Mitarbeiters vom Arbeitgeber zugelassen wird, jedoch unter der vollen Verantwortung des Mitarbeiters, und dass sie weiterhin dem Schweizer Recht unterliegt, wobei das zwingende französische Arbeitsrecht für die Tätigkeit, die der Mitarbeiter in Frankreich ausübt, vorbehalten bleibt.
Wer trägt die Kosten für die Telearbeit? Das kommt darauf an.
Um diese Frage zu beantworten, muss unterschieden werden, ob die Telearbeit vom Arbeitgeber vorgeschrieben oder auf Wunsch des Arbeitnehmers eingeführt wird. Im ersten Fall muss der Arbeitgeber die Ausrüstung zur Verfügung stellen oder den Arbeitnehmer für die Bereitstellung der privaten Ausrüstung entschädigen. Eine monatliche Pauschalentschädigung von CHF 30 für die Nutzung von privatem Standardmaterial und CHF 300 für die Miete für die Nutzung eines Zimmers während der Bürozeiten für eine Vollzeitkraft (einschließlich Heizung, Strom, Internet- und Telefonabonnement) in der Genferseeregion würde akzeptabel erscheinen. Diese Entschädigung müsste bei einer Teilzeitbeschäftigung und in der Grenzregion proportional gesenkt oder angepasst werden.
Falls die Telearbeit auf Wunsch des Arbeitnehmers ausgeführt wird und der Arbeitnehmer über einen ausgestatteten Arbeitsplatz in den Räumlichkeiten des Unternehmens verfügt, ist es grundsätzlich seine Aufgabe, die mit der Telearbeit verbundenen Kosten zu tragen.
Die Telearbeitsvereinbarung
Es wird empfohlen, die verschiedenen Aspekte des Vertragsverhältnisses des französischen Telearbeiters in einer Telearbeitsvereinbarung zu regeln. Diese behandelt idealerweise alle oben genannten Aspekte, insbesondere die Verpflichtungen zur Einhaltung der oben genannten Grenzen sowie des schweizerischen und des zwingenden französischen Arbeitsrechts. Sie wird auch die Verpflichtung enthalten, eine genaue Abrechnung der oben genannten Daten zu führen, jede Änderung in der Situation des Arbeitnehmers und die Folgen, die sich aus der Überschreitung dieser Grenzen ergeben, zu melden und schließlich die Frage der Kosten zu regeln.
Quellen:
- Wegleitung über die Versicherungspflicht in der AHV und IV (WVP), gültig ab 1.1.2009, Stand 1.1.2024.
- Weisung über die Besteuerung von Grenzgängern mit Wohnsitz in Frankreich, die in der Schweiz bei einem waadtländischen Arbeitgeber eine unselbstständige Erwerbstätigkeit ausüben, für das Jahr 2023 herausgegeben von der Kantonsverwaltung Waadt.
- Doppelbesteuerungsabkommen der Schweiz mit Frankreich sowie weitere Publikationen zu den Beziehungen zwischen den beiden Staaten, insbesondere im Zusammenhang mit Grenzgängern und Telearbeit
- Merkblatt vom 23. Oktober 2023 zu den einvernehmlichen französisch-schweizerischen Vereinbarungen über die Regelung der Ausübung von Telearbeit im Rahmen des Grenzabkommens vom 11. April 1983
- Le télétravail, Questions de droit du Centre Patronal Vaudois, Novembre - décembre 2022 / n° 138.
- Le télétravail, Défago Valérie, Jean-Philippe Dunand, Pascal Mahon, Schultess éditions romandes, 2022.
- Les conséquences du télétravail transfrontalier sur le système de sécurité sociale et le régime fiscal des travailleurs, mémoire présenté par Julia Mühlberg, sous la direction du Professeur Rémy Wyler, 13 avril 2023.
Neueste Aktualitäten

Nouveautés RH pour 2026
L’année 2026 marque plusieurs évolutions majeures en droit du travail, assurances sociales et fiscalité, avec des impacts concrets pour les employeurs et les salariés. Nous faisons le point sur les changements au niveau national ainsi que sur les mesures spécifiques au canton de Genève.

Votation populaire du 30 novembre 2025 : initiative pour l’avenir
Le 30 novembre 2025, les électeurs suisses seront appelés à se prononcer sur une initiative visant à instaurer un impôt fédéral de 50 % sur les successions et donations dépassant 50 millions de francs. Pensée pour financer la transition écologique, cette mesure soulève des questions concrètes pour les familles propriétaires de PME, les entrepreneurs et les détenteurs de patrimoine important.

Reform der Wohneigentumsbesteuerung
Reform der Immobilienbesteuerung in der Schweiz: Abschaffung des Eigenmietwerts, neue Abzugsregeln, Steuer auf Zweitwohnungen. Lesen Sie die Analyse unserer Steuerexperten.